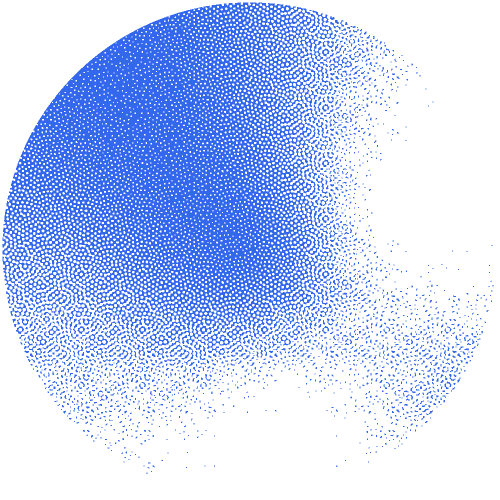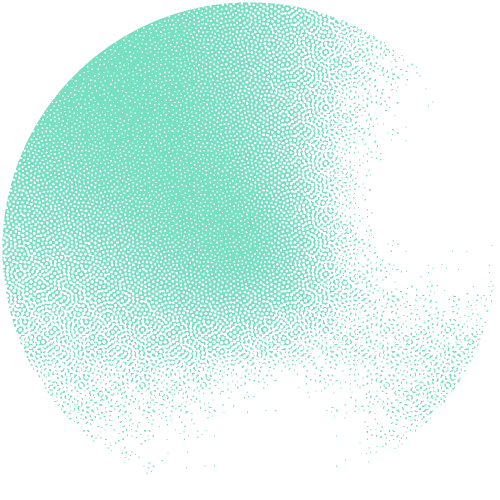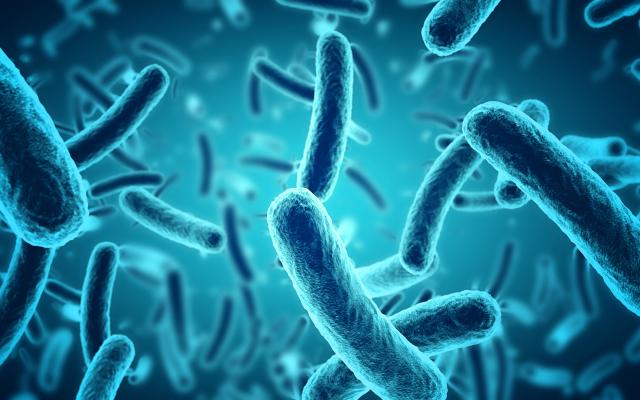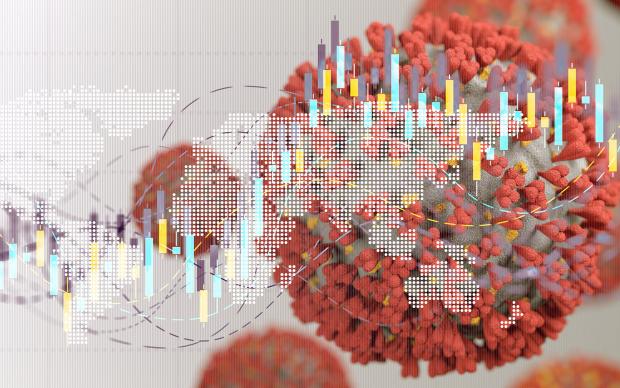Antibiotikaresistenzen werden weltweit zu einem immer grösseren Problem. Die Swiss Pathogen Surveillance Platform (SPSP) ist ein wichtiges Instrument zur Überwachung und Eindämmung antibiotikaresistenter und gefährlicher Bakterien und Viren. Dieses Interview von Alexandra Bucher wurde ursprünglich in der Beilage «Life Science» der Basler Zeitung vom 2. September 2022 veröffentlicht. Es wurde aus Gründen der Länge gekürzt und aus dem Deutschen übersetzt.

Sonderbeilage Life Science (02.09.22), von Alexandra Bücher (gekürzt und aus dem Deutschen übersetzt)
Die SPSP-Plattform macht die genetischen Daten von Krankheitserregern für Forschende und Labors in der Schweiz und weltweit zugänglich. Ziel ist es, die Ausbreitung antibiotikaresistenter und gefährlicher Bakterien besser zu verstehen und zu bekämpfen. Aitana Neves ist Teamleiterin Data Science bei SIB und verantwortlich für SPSP. Sie und Adrian Egli beantworten in diesem Interview Fragen zur Plattform. Adrian Egli ist klinischer Mikrobiologe und leitet das Institut für Medizinische Mikrobiologie an der Universität Zürich. Er ist Projektleiter und Mitbegründer von SPSP.
Die Antibiotikaresistenz nimmt weltweit zu. Was sind die Gründe dafür?
Adrian Egli: Antibiotika werden sowohl in der Human- als auch in der Veterinärmedizin häufig eingesetzt. Dadurch können sich Antibiotika in der Umwelt anreichern. Durch den weit verbreiteten und unkontrollierten Einsatz werden Bakterien resistent und gelangen aus der Umwelt und von Tieren, unter anderem über die Nahrungskette, zurück zum Menschen. Dieser Kreislauf hat im Laufe der Jahre zu einer Zunahme der Antibiotikaresistenzen geführt.
Sie untersuchen auch Viren wie SARS-CoV-2. Warum?
Adrian Egli: Glücklicherweise entwickeln Viren, die Atemwegsinfektionen verursachen, nicht so viele Resistenzprobleme. Aber Viren können Menschen sehr schwer krank machen. Was wir über Viren – insbesondere SARS-CoV-2 – wissen wollen, ist beispielsweise, ob eine neue Variante auftaucht, gegen die der Impfstoff nicht mehr wirkt. Mit der Überwachung können wir beurteilen, was derzeit im Umlauf ist und ob ein Impfstoff noch wirksam ist.
Was sind die Parallelen zwischen der Erforschung von Viren und der Erforschung antibiotikaresistenter Bakterien?
Aitana Neves: In beiden Fällen bestimmen wir die Mutationen im Erbgut der Mikroorganismen durch Sequenzierung. So können wir die Entwicklung von SARS-CoV-2 oder eines Bakteriums zurückverfolgen und die Übertragungsketten überwachen. Wir vergleichen verschiedene bakterielle oder virale Isolate, um festzustellen, ob sie miteinander verwandt sind oder nicht. Wir untersuchen die Anhäufung von Mutationen im Laufe der Zeit. Dann fragen wir uns, welche anderen Faktoren die Übertragung begünstigen könnten – sei es Alter, Geschlecht oder geografische Lage wie beispielsweise die Kantonszugehörigkeit.
Wann, wie und warum haben Sie SPSP gegründet? Was ist das Schweizerische Institut für Bioinformatik und in welcher Beziehung steht es zu SPSP?
Aitana Neves: SIB ist eine nationale Organisation, die sich mit biologischen und biomedizinischen Daten befasst. Alle Krankenhäuser und klinischen Labors können Sequenzierungsdaten an SIB übermitteln, die über das erforderliche Fachwissen verfügt, um diese sensiblen Daten zu speichern und zu verwalten. Als wir vor vielen Jahren Adrian Egli trafen, hatten wir die Idee für die Plattform. Und so begann alles: Wir brachten alle Forschungseinrichtungen zusammen, und SIB baute die Plattform auf.
Wie hat sich die Plattform seitdem entwickelt?
Adrian Egli: Die SARS-CoV-2-Pandemie hat unserer Plattform sicherlich einen Schub gegeben. Wir alle haben erkannt, wie wichtig es ist, zu wissen, welche Varianten im Umlauf sind. Ursprünglich waren wir eine kleinere Gruppe von Forschern. Während der Corona-Pandemie kamen weitere Forscher und Labore hinzu. Inzwischen haben sich die Universitäten und Universitätskliniken von Basel, Bern, Genf, Lausanne und Zürich sowie viele andere kantonale und private Labore dem SPSP angeschlossen. Alle Sequenzierungsdaten in der Schweiz laufen über das SPSP.
Sie unterstützen das Bundesamt für Gesundheit (BAG) im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie bei der Verfolgung der Varianten. Wie sieht diese Unterstützung aus?
Aitana Neves: Seit Juli 2021 leiten alle privaten und öffentlichen Labors ihre Sequenzen an die SPSP weiter. Dies hilft dem BAG, da es alle genetischen Informationen zu SARS-CoV-2 an einer zentralen Stelle erhält und weiterleiten kann. Das SPSP sendet dreimal pro Woche einen Bericht an das BAG. Zuvor analysieren wir die Daten, standardisieren sie und bringen sie in eine für das BAG verarbeitbare Form. So weiss das BAG, wo das Virus und seine Varianten zirkulieren. Das BAG fasst diese Daten für sein COVID-19-Dashboard auf, das es regelmässig aktualisiert und öffentlich zugänglich macht.
SPSP trägt zu Open Science bei. Was bedeutet das?
Aitana Neves: Das bedeutet, dass Forscherinnen und Forscher weltweit auf die anonymisierten Daten und insbesondere auf die genetischen Informationen der Mikroorganismen zugreifen können. Die SPSP hat sich sehr aktiv an der Weitergabe von COVID-19-Sequenzdaten beteiligt. Damit gehört die Schweiz zu den fünf Ländern weltweit, die die meisten frei zugänglichen SARS-CoV-2-Sequenzen zur Verfügung stellen. Dies positioniert die Schweiz als international führend in diesem Forschungsbereich und leistet einen wichtigen Beitrag zum besseren Verständnis der Ausbreitung von Infektionskrankheiten.
Blick in die Zukunft: Was passiert, wenn es uns nicht gelingt, multiresistente Bakterien auszurotten?
Adrian Egli: Ich vergleiche das gerne mit dem Klimawandel. Wir spüren ihn nur allmählich. Aber der Klimawandel ist eine ernste Realität und schreitet langsam, aber stetig voran. Auch die Antibiotikaresistenz ist ein Problem, das langsam zunimmt. Es ist enorm wichtig, dass wir uns dieses Problems bewusst werden und den Einsatz von Antibiotika beeinflussen. Wir brauchen Antibiotika in ganz alltäglichen Situationen, zum Beispiel bei einem Kaiserschnitt oder wenn jemand während einer Chemotherapie eine Lungenentzündung bekommt. Solche Behandlungen werden nicht mehr möglich sein, wenn wir multiresistente Keime haben.