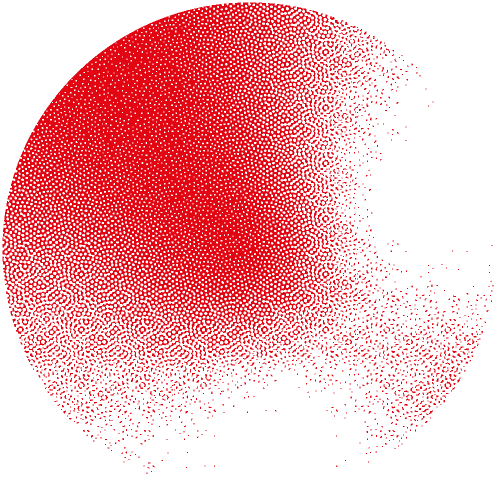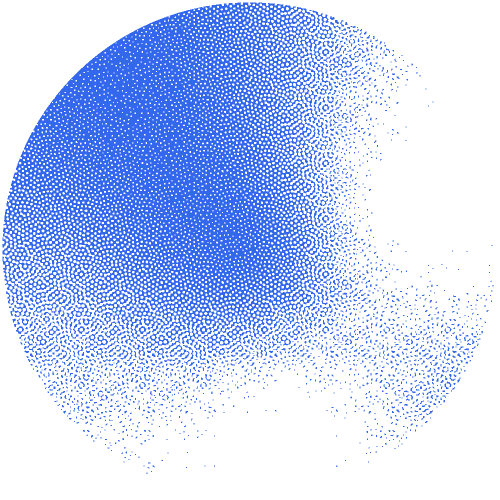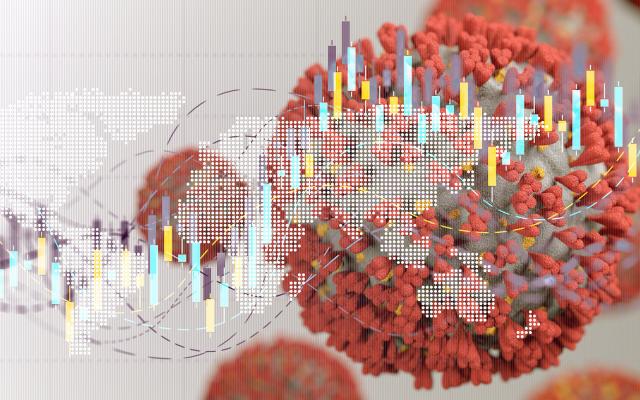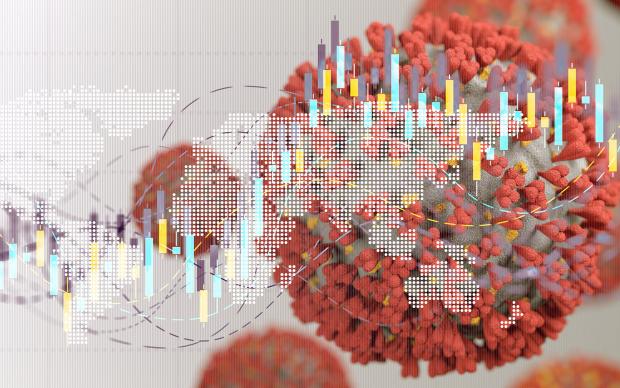Heute dominiert die Delta-Variante des Virus in der Schweiz. Dies ist nur dank einer beispiellosen Sequenzierungsaktion möglich. Im Zentrum dieses Prozesses steht eine nationale Infrastruktur, die vom SIB Swiss Institute of Bioinformatik mitgeleitet wird und nun alle in der Schweiz gesammelten genetischen Sequenzen des Virus zentralisiert. Einerseits versorgt sie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mit einem automatisierten Überblick über die Verbreitung und das Auftreten von Varianten im ganzen Land. Andererseits ermöglicht sie den schnellen und massenhaften Austausch von Schweizer Sequenzen mit internationalen Datenbanken. Damit gehört die Schweiz zu den weltweit grössten Lieferanten von SARS-CoV-2-Sequenzen und beschleunigt so die Forschung an Impfstoffen und Therapien.
Über die Swiss Pathogen Surveillance Platform (SPSP)
SPSP.ch ist eine kollaborative Plattform , die dem Onehealth-Ansatz folgt , d. h. multidisziplinär ist und unter anderem darauf abzielt, die Gesundheit der Menschen zu optimieren. Sie wird gemeinsam von der SIB in Zusammenarbeit mit den Universitätsspitäler von Basel, Lausanne und Genf sowie den Universitäten Bern und Zürich verwaltet (siehe vollständige Liste der Partner, die Daten bereitstellen). Sie wird auf der sicheren IT-Infrastruktur der SIB gehostet und entspricht den Datensicherheitsstandards des Swiss Personalised Health Network (SPHN).
Die Notwendigkeit einer koordinierten Überwachung von Varianten auf nationaler Ebene
Gestern Alpha, heute Delta und morgen vielleicht schon Mu: Die Schweiz ist auf der Hut vor dem Auftreten neuer Varianten und deren Übertragungsketten. Die Sequenzierung des Virusgenoms ermöglicht es, anhand eines positiven PCR-Tests die Identität der betreffenden Variante und ihr vollständiges genetisches Profil zu bestimmen. Allein im August 2021 wurden mehr als 5600 Sequenzen von über zehn akademischen oder privaten Labors in der ganzen Schweiz analysiert. Diese Daten sind jedoch nur sinnvoll, wenn sie so schnell wie möglich miteinander verknüpft werden – daher sind Koordination und Standardisierung unerlässlich.
Hier kommt eine kollaborative und sichere Infrastruktur ins Spiel, die von der SIB mitgeleitet wird. Ihr Name? Swiss Pathogen Surveillance Platform (SPSP). Ihre Aufgabe? Die SARS-CoV-2-Genomsequenzen aus Laboren in der Schweiz sowie die Begleitdaten (Datum des PCR-Tests, Probenentnahmemethode, Grund für die Sequenzierung, verwendetes Gerät, Ort des Tests, Geschlecht und Alter des Patienten) zu zentralisieren, zu harmonisieren und zu annotieren. Ihr Ziel? Die Unterstützung der nationalen Genomüberwachungsstrategie, die gemeinsam vom Nationalen Referenzzentrum für neu auftretende Virusinfektionen (CRIVE) und dem BAG durchgeführt wird. Die Plattform ermöglicht den Behörden einen umfassenden und automatisierten Überblick über die Sequenzierung in der Schweiz und speist internationale Datenbanken, die für die Forschung zum Virus genutzt werden.
«Bislang stammen die Sequenzen, die wir erhalten haben, aus fast allen Schweizer Kantonen: Das ist eine hervorragende Nachricht, denn so ist es unwahrscheinlich, dass neue Varianten unbemerkt bleiben», erklärt Aitana Lebrand, Teamleiterin Data Science bei der SIB und verantwortlich für die SPSP-Plattform.
Beschleunigung der Überwachung der Epidemie in der Schweiz
Dreimal pro Woche sendet die Plattform ihren Genomüberwachungsbericht an das BAG. Das BAG integriert ihn in seine Statistiken und kann die Informationen auch mit den Patientendaten zu Krankenhausaufenthalten, Impfungen, Symptomen zum Zeitpunkt des Tests usw. abgleichen. So könnte festgestellt werden, dass eine der beobachteten Mutationen mit einer höheren Pathogenität oder einer höheren Resistenz gegen Impfstoffe in Verbindung zu stehen scheint.
«Dank der von SIB entwickelten Überwachungsplattform können wir über einen einzigen Zugang auf eine zentralisierte und standardisierte Datenbank zugreifen, anstatt Berichte von jedem Labor in unterschiedlichen Formaten zu erhalten», erklärt Mirjam Mäusezahl, Co-Leiterin der Abteilung Epidemiologie beim BAG. «Für uns bedeutet dies eine enorme Zeitersparnis und eine höhere Granularität bei der Analyse der Sequenzierungsdaten. So können wir uns auf die Anpassung der Gesundheitspolitik konzentrieren.»
Förderung der internationalen Forschung durch Erleichterung der offenen Wissenschaft
Mit finanzieller Unterstützung des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation( SBFI) übermittelt die SPSP-Plattform vollständig anonymisierte Virussequenzen an offene Wissenschaftsplattformen wie das europäische COVID-19-Portal, um die internationale Forschung zu fördern. Dank dieser Bemühungen liegt die Schweiz derzeit anvierter Stelle hinter Grossbritannien, den USA und Deutschland, was die Anzahl der geteilten SARS-CoV-2-Sequenzen angeht. Diese öffentlichen Datenbanken sind von grundlegender Bedeutung für die Untersuchung und das Verständnis der Rolle der beobachteten Variationen auf die Pathogenität des Virus, seine Wechselwirkungen mit Wirtszellen zum Zeitpunkt der Infektion sowie für die Entwicklung von Impfstoffen und Behandlungen
Was kommt als Nächstes? Eine nationale SPSP-Anwendung, über COVID-19 hinaus
Diese Zusammenarbeit mit dem BAG im Kontext der aktuellen Pandemie steht im Einklang mit der ursprünglichen Aufgabe der SIB-Plattform: Fachleuten soll es ermöglicht werden, das Auftreten und die Ausbreitung von Krankheitserregern rasch zu erkennen und frühzeitig Massnahmen zu ergreifen, um die Übertragung einzudämmen, indem sie nahezu in Echtzeit verfolgt werden. Bevor COVID-19 die Forschungsschwerpunkte veränderte, konzentrierte sich SPSP speziell auf multiresistente Bakterien. «Im Zeitalter der Sequenzierung erfüllt dieses Instrument einen wesentlichen Bedarf der Mikrobiologen nach einer harmonisierten und zentralisierten Analyse der molekularen Profile von Infektionserregern auf nationaler Ebene», kommentiert Adrian Egli, Leiter der Abteilung für Bakteriologie und Mykologie am Universitätsspital Basel und Co-Leiter der Plattform.
«Die Möglichkeit, SPSP langfristig zu nutzen, um Genomdaten neu auftretender Bakterien oder Viren in der Schweiz mit epidemiologischen Daten zu verknüpfen, ist vielversprechend, um eine vorbildliche Reaktionsfähigkeit des Landes im Bereich der öffentlichen Gesundheit sicherzustellen», schliesst Mirjam Mäusezahl.
Lesen Sie die Pressemitteilung auf Französisch und Deutsch
Ausgewählte Presseberichte: Le Temps, Heidi.news, RTS La 1ère CQFD, Tages Anzeiger