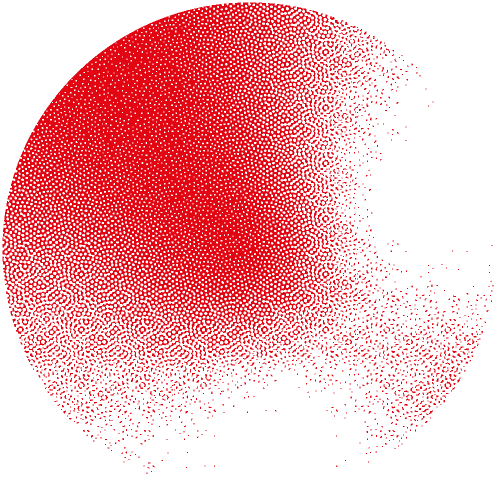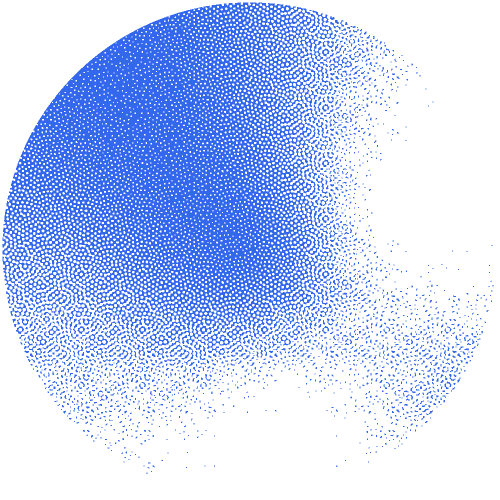Jakob Ruess – Mitgewinner des SIB Best Swiss Bioinformatics Graduate Paper Award 2012
Jakob Ruess erhielt die Auszeichnung gemeinsam mit Christoph Zechner als Co-Autor der Publikation„Moment-based inference predicts bimodality in transient gene expression”. Die Arbeit entstand im Rahmen von Jakobs Doktoratsstudium im Team von John Lygeros an der ETH Zürich.
Jakob hat nun eine feste Stelle als Gruppenleiter in Frankreich. Sein Team ist sowohl dem französischen nationalen Forschungsinstitut für Informatik und angewandte Mathematik (INRIA) als auch dem Zentrum für Bioinformatik, Biostatistik und integrative Biologie (C3BI) am Pasteur-Institut in Paris angegliedert. Eines der Hauptziele von Jakobs Forschung ist die Entwicklung mathematischer Modelle, mit denen sich die Dynamik biologischer Systeme darstellen, verstehen und schließlich steuern lässt. Weitere Informationen zu seinen Forschungsinteressen finden Sie auf der Webseite von Jakobs Gruppe und in unserem Interview.
Über die SIB Bioinformatics Awards und unsere Interviewreihe «Treffen Sie die früheren Preisträger der SIB Awards»
Die SIB Bioinformatics Awardswurden 2008 ins Leben gerufen, um junge Bioinformatiker in der Schweiz auszuzeichnen. Seitdem haben sie sich weiterentwickelt: von einer einzigen nationalen Auszeichnung zu drei verschiedenen Preisen, mit denen heute 1) internationale Nachwuchsbiinformatiker (SIB Early Career Bioinformatician Award), 2) herausragende Leistungen innerhalb der Schweizer Doktoranden-Community (SIB Best Swiss Bioinformatics Graduate Paper Award) und 3) innovative Bioinformatik-Ressourcen (SIB Bioinformatics Resource Innovation Award) ausgezeichnet werden. Im Laufe der Jahre wurden 21 Auszeichnungen vergeben, darunter neun Preisträger für ihre herausragende frühe Karriere, zehn Doktoranden für ihre exzellente Publikation und zwei Bioinformatik-Ressourcen für ihren innovativen Aspekt.
2019 werden die SIB Bioinformatics Awards zumzehnten Malverliehen. Dies ist eine gute Gelegenheit, um mit früheren Preisträgern in Kontakt zu treten und sie zu fragen, wo sie heute in ihrer Karriere stehen: Dieses Interview ist Teil einer Reihe, in der Sie ehemalige Preisträger der SIB Bioinformatics Awards kennenlernen können.
An welchem Punkt Ihrer Karriere standen Sie, als Sie den SIB Award erhalten haben? Wie haben Sie sich dabei gefühlt? Was war zu diesem Zeitpunkt der Schwerpunkt Ihrer Forschung?
Ich war Doktorand und hatte gerade mein erstes Jahr abgeschlossen! Natürlich war es ein unglaubliches Gefühl, so früh in meiner Karriere eine so renommierte Auszeichnung zu erhalten. Das hat mich sehr motiviert und sicherlich auch dazu beigetragen, dass ich mich für eine akademische Laufbahn entschieden habe und die Möglichkeit dazu hatte. Der Preis wurde für eine Arbeit verliehen, in der wir eine Methode entwickelt haben, mit der sich stochastische kinetische Modelle aus Einzelzell-Genexpressionsdaten ableiten lassen, und diese Methode zur Charakterisierung der Zell-zu-Zell-Variabilität bei der Reaktion auf osmotischen Stress in Hefe eingesetzt haben. Was ich heute mache, ähnelt in vielerlei Hinsicht noch immer dieser Art von Arbeit, aber die Biologie entwickelt sich so schnell, dass sich die Herausforderungen ständig ändern und erneuern.
Was sind Ihre aktuellen Forschungsinteressen?
Unter den „drei Bs“ des C3BI lässt sich meine Arbeit am besten als „Integrative Biologie“ einordnen. Ich komme ursprünglich aus der Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie, interessiere mich aber nicht so sehr für die Trends „große Datensätze“ und „maschinelles Lernen“ in der Bioinformatik. Was mich wirklich motiviert, ist die Faszination, mathematische Modelle zu entwickeln, mit denen wir die dynamischen Vorgänge des Lebens erklären und simulieren können, und diese Modelle auch im Kontext der synthetischen Biologie zu nutzen, um selbst lebende Systeme zu entwerfen. Derzeit ist dies nur in kleinem Maßstab realistisch möglich, daher konzentrieren wir uns in der Regel auf die Untersuchung spezifischer biochemischer Prozesse in Zellen. Derzeit arbeiten wir beispielsweise daran, stochastische Prozesse zur Modellierung einfacher synthetischer Gen-Netzwerke wie dem „Toggle Switch“ oder dem „Repressilator“ zu nutzen – einfache Netzwerke, in denen Gene entweder aktiv (eingeschaltet) oder inaktiv (ausgeschaltet) sind. Das Tolle daran ist, dass wir am Pasteur-Institut über ein eigenes Biologielabor verfügen und Studenten haben, die solche Netzwerke aufbauen können, um detaillierte Daten über ihre Dynamik zu generieren. Vor kurzem haben wir auch damit begonnen, unsere experimentellen Plattformen zu automatisieren. Das klingt zunächst nur nach einer technischen Herausforderung, aber wenn man etwas genauer darüber nachdenkt und sich fragt, was man mit einer intelligenten und autonomen Mikroskopieplattform alles machen kann – die beispielsweise in der Lage ist, optogenetisch (Anm. d. Red.: mithilfe von Licht) die Genexpression in einzelnen Zellen zu induzieren und zu messen –, wird einem klar, dass sich damit eine ganz neue Welt möglicher Experimente eröffnet. Die Plattform ist dann nicht mehr nur ein Gerät zur Durchführung Ihres Experiments, sondern wird zu einer Schnittstelle für die Interaktion mit Zellen. Ich weiß, das klingt ein bisschen wie Science-Fiction, aber die Idee ist wirklich, die Biologie zu verstehen, indem man Computerprogramme entwickelt, die in Echtzeit mit Gen-Netzwerken kommunizieren. Das wird wahrscheinlich einer meiner Schwerpunkte in den nächsten Jahren sein, wenn ich ambitionierte Studierende oder Postdocs finde, die sich nicht scheuen, sich auf ein so neues wissenschaftliches Thema einzulassen.
Was ist Ihrer Meinung nach die faszinierendste Entdeckung, die durch die Bioinformatik ermöglicht wurde?
Ich möchte nicht wirklich auf eine einzelne Entdeckung verweisen. Was uns wirklich voranbringt, ist der Fluss der Wissenschaft als Ganzes, und die Bioinformatik ist einer der Motoren, die diesen Fluss am Laufen halten. Meiner Meinung nach entspringt das Denken in bahnbrechenden Ergebnissen unserem menschlichen Wunsch, Dinge zu kategorisieren und zu quantifizieren, aber es wird dem eigentlichen wissenschaftlichen Prozess nicht wirklich gerecht.
Was machst du gerne in deiner Freizeit?
Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass es als Wissenschaftler immer schwieriger wird, klare Grenzen zwischen Arbeitszeit und Freizeit zu ziehen. Ist die Zeit, die ich mit der Beantwortung dieser Frage verbringe, Arbeitszeit oder Freizeit? Ich würde sagen, wenn ich nicht an meinem Schreibtisch sitze, diskutiere ich gerne beim Mittagessen, bei einem Bier oder Kaffee mit meinen Kollegen und Freunden aus aller Welt, die oft sehr gegensätzliche Meinungen haben, über wissenschaftliche, politische, gesellschaftliche, ökologische (und was sonst noch alles) Themen. In letzter Zeit lese ich auch ziemlich viele französische Bücher, da es schließlich nützlich ist, die Sprache des Landes zu lernen, in dem man lebt. Wenn ich Urlaub mache, versuche ich normalerweise, an einen ruhigen Ort zu fahren, um dem geschäftigen Paris für eine Weile zu entfliehen. Leider sind die Alpen etwas weiter weg als zu meiner Zeit in der Schweiz.
Haben Sie einen Rat für die nächste Generation von Bioinformatikern?
In der Wissenschaft im Allgemeinen und vielleicht in der Biologie und Bioinformatik im Besonderen gibt es immer einige Themen, die sehr im Trend liegen. Es ist nichts Falsches daran, dass ein Thema im Trend liegt. Dafür gibt es in der Regel einen guten Grund: In der Bioinformatik ist es oft so, dass eine bestimmte Art von Daten weit verbreitet ist und der Bedarf an Methoden zur Analyse dieser Daten steigt. Was wir jedoch manchmal vergessen, ist, dass sich experimentelle Technologien mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit weiterentwickeln. Wenn wir also Methoden entwickeln, sollten wir auch berücksichtigen, welche Art von Daten in Zukunft wahrscheinlich verfügbar sein werden, da unsere Methoden sonst immer hinter den Anforderungen der Biologie zurückbleiben. Um noch einen Schritt weiter zu gehen, denke ich, dass die Analyse von Daten nicht die einzige Aufgabe eines Bioinformatikers ist. Wir müssen auch dazu beitragen, herauszufinden, welche Daten überhaupt benötigt werden, um offene biologische Fragen zu klären. Das bedeutet, dass wir uns aktiv an der Entwicklung experimenteller Technologien beteiligen oder zumindest sicherstellen sollten, dass wir über sehr gute Kommunikationskanäle zu den Menschen verfügen, die an diesen Dingen arbeiten.