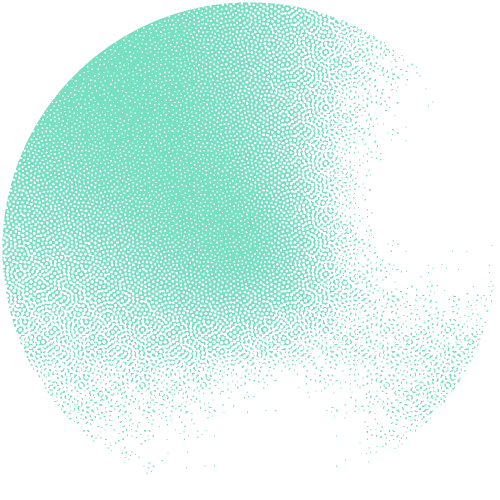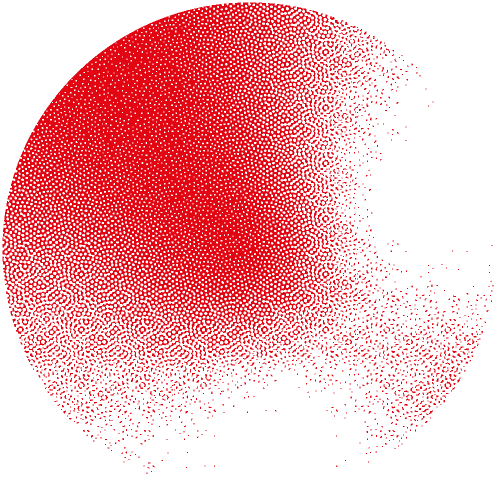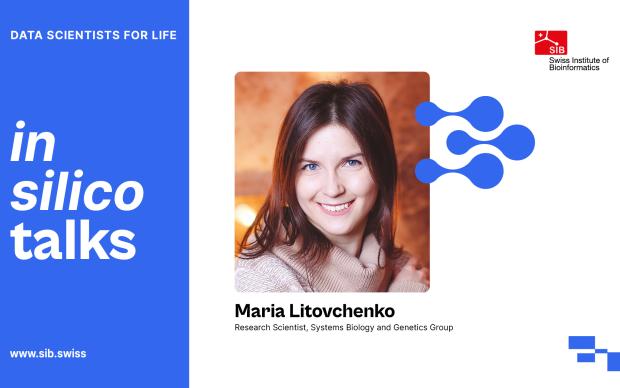Im Laufe der Evolution haben Tiere wiederholt von sexueller zu asexueller Fortpflanzung gewechselt. Die ersten Hinweise auf die Folgen der Parthenogenese – einer Form der asexuellen Fortpflanzung – für die Genomentwicklung wurden in einer internationalen Studie unter der Leitung von Wissenschaftlern der UNIL und des SIB veröffentlicht. Die Ergebnisse helfen zu erklären, warum Arten, die sich auf diese Weise fortpflanzen, in der freien Natur, wo sich die Umwelt ständig verändert, im Allgemeinen anfälliger sind. Die Studie wurde heute in Science Advances veröffentlicht.
Sexuelle und asexuelle Fortpflanzung
Die Fortpflanzung erfolgt hauptsächlich auf zwei Arten: geschlechtlich (Befruchtung zwischen zwei Geschlechtszellen, einer männlichen und einer weiblichen) und ungeschlechtlich. Die Parthenogenese ist eine Form der ungeschlechtlichen Fortpflanzung: Weibchen geben ihre Gene ohne Beteiligung von Männchen weiter.
Die Folgen der asexuellen Fortpflanzung
Die Studie unter der Leitung von Kamil Jaron und Darren Parker und unter Mitwirkung von Tanja Schwander und Marc Robinson-Rechavi vom Departement für Ökologie und Evolution (DEE) der UNIL sowie Nicolas Galtier vom Institut für Evolutionswissenschaften in Montpellier (Frankreich) hat erstmals die Auswirkungen der Parthenogenese auf die Evolution der Genome bestimmter Tiere aufgezeigt. Drei wesentliche Auswirkungen wurden festgestellt: Verlust der Effizienz bei der Selektion von Mutationen, die einen größeren Fortpflanzungserfolg versprechen, Verringerung der genetischen Vielfalt und drastischer Rückgang der Heterozygotie.
Stabheuschrecken als Studienobjekte
Die Ergebnisse wurden anhand von Stabheuschrecken, insbesondere der Gattung Timema, als untersuchte Spezies erzielt. Die Wissenschaftler entdeckten, dass sexuelle Fortpflanzung eine schnelle Anpassung und genetische Vielfalt in natürlichen Populationen von Stabheuschrecken begünstigt. Damit konnten sie zunächst theoretisch aufgestellte Hypothesen empirisch bestätigen, beispielsweise warum sich asexuell fortpflanzende Arten in der freien Natur, wo sich die Umwelt ständig verändert, generell anfälliger sind. Die Experten analysierten die Genome von fünf asexuellen Timema-Arten und von eng verwandten sexuellen Arten und verglichen deren Gehalt an transponierbaren Elementen (DNA-Sequenzen, die ihre Position innerhalb eines Genoms verändern können), die unter positiver Selektion stehenden Gene und die Heterozygotie. Die Analyse umfasste die Verwendung von OrthoDB, Teil der SIB-Ressource SwissOrthology, um entsprechende Gene bei allen untersuchten Arten zu identifizieren und deren Evolution zu vergleichen.
Reference(s)
Jaron K S, Parker D J. et al. Konvergente Auswirkungen der Parthenogenese auf das Genom von Stabheuschrecken. Science Advances 2022.
Bildnachweis für das Banner: Bart Zijlstra