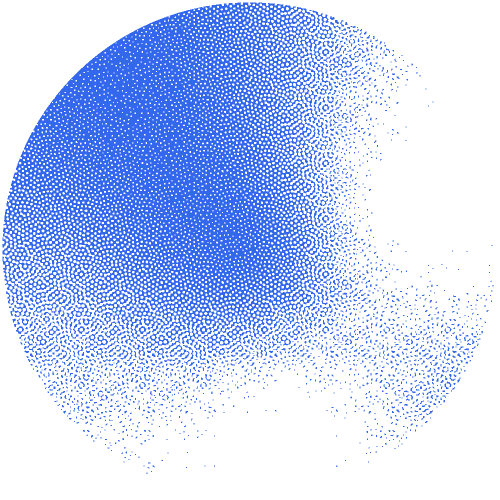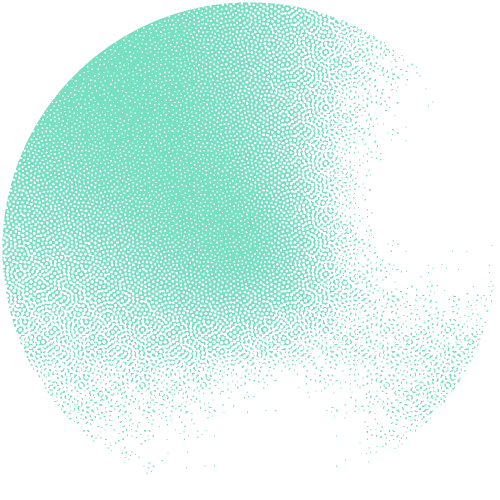Offene Forschungsdaten (Open Research Data, ORD) gelten zwar weithin als ein Kernprinzip, das zum Allgemeinwissen beiträgt, werfen jedoch komplexe rechtliche Fragen sowohl im Bereich sensibler als auch nicht sensibler Daten auf. Die SIB spielt seit langem eine wichtige Rolle im Bereich ORD für Daten aus den Lebenswissenschaften und hat in diesem Zusammenhang rechtliches Know-how aufgebaut. Ein von den Rechtsexperten der SIB veröffentlichter Artikel bietet einen Überblick über die in diesem Bereich in der Schweiz geltenden Rechtsvorschriften. Er enthält auch eine Checkliste mit Punkten, die vor der Freigabe von Daten für die biomedizinische Forschung zu berücksichtigen sind.
Von ORD-Anreizen zur Umsetzung: ein Balanceakt
Die Grundsätze der offenen Wissenschaft und insbesondere der offenen Forschungsdaten zielen darauf ab, dass aus öffentlichen Mitteln finanzierte Forschungsergebnisse so geteilt und genutzt werden, dass ihr Nutzen für die Gesellschaft maximiert wird. Initiativen zu ihrer Förderung entstehen sowohl auf internationaler (z. B. UNESCO) als auch auf nationaler Ebene (z. B. Schweizerische Strategie für offene Forschungsdaten). Sie werden häufig mithilfe von Anreizinstrumenten umgesetzt, beispielsweise durch die Festlegung von ORD-Zielen als Förderbedingung in Forschungsanträgen. Im Kontext biomedizinischer Daten bedeutet die Förderung von ORD jedoch, dass Ziele der Datenfreigabe mit den geltenden Rechtsvorschriften in Einklang gebracht werden müssen. Dazu können Datenschutz, Berufsgeheimnis und/oder Rechte des geistigen Eigentums gehören. «Bislang wurde diesem Thema aus Sicht des Schweizer Rechts wenig Aufmerksamkeit geschenkt», sagt Frédéeric Erard, Leiter des Legal and Technology Transfer Office (LTTO) bei SIB. „Mit dieser Übersicht über die geltenden Rechtsvorschriften zu ORD laden wir die Schweizer Rechtsgemeinschaft ein, weiterhin nach Lösungen zu suchen, die die biomedizinische Forschung vorantreiben und gleichzeitig die Rechte der Teilnehmenden gewährleisten.“
Eine Checkliste für Rechtsabteilungen in Forschungseinrichtungen
Das Papier berücksichtigt den spezifischen Kontext der biomedizinischen Forschung, in dem Daten oft eng mit Personen verknüpft und daher «sensibel» sind. Anhand einer Reihe von Fragen und Antworten (z. B. «Sind die betreffenden Daten durch andere Rechtsvorschriften geregelt?») schlagen die Autoren eine Checkliste mit Elementen vor, die vor der Öffnung von Daten für die biomedizinische Forschung zu berücksichtigen sind, um die bestmögliche Strategie zu wählen.
Herausforderungen ergeben sich sowohl für sensible als auch für nicht sensible Daten
In der Schweiz können sich Forscher in der Regel auf die allgemeine Einwilligung der Teilnehmer zur Weiterverwendung und Weitergabe ihrer Gesundheitsdaten für Forschungszwecke verlassen. Dies erfordert jedoch die Einführung eines vertraglichen Rahmens, der die Rechte der Teilnehmenden und die Datensicherheit gewährleistet. Im Rahmen des Swiss Personalized Health Network (SPHN) wurden in enger Zusammenarbeit mit dem LTTO und der Gruppe Personalized Health Informatics der SIB Vertragsvorlagen ausgearbeitet und öffentlich zugänglich gemacht. Dieser Rahmen ermöglicht ambitionierte multizentrische biomedizinische Forschungsprojekte, beispielsweise in der pädiatrischen Forschung oder Onkologie.
Trotz seiner geringeren rechtlichen Sensibilität erfordert auch die Weitergabe nicht personenbezogener (z. B. anonymisierter) Daten für medizinische Forschungszwecke eine sorgfältige Strategie. Eine wirksame Möglichkeit hierfür ist die Verknüpfung der hinterlegten Daten mit freien Lizenzen, wie beispielsweise Creative-Commons-Lizenzen. Dies ist beispielsweise bei den SIB Resources der Fall, einem Portfolio mit wichtiger Software und Datenbanken für die Lebenswissenschaften, die auf Open-Science-Ziele ausgerichtet sind und die Wiederverwendung von Daten durch geeignete Lizenzen (z. B. CC BY 4.0) unterstützen.
Reference(s)
Erard F, Heusghem M, Parisato C, Biomedizinische Forschung und Open Data, Weblaw 2023.